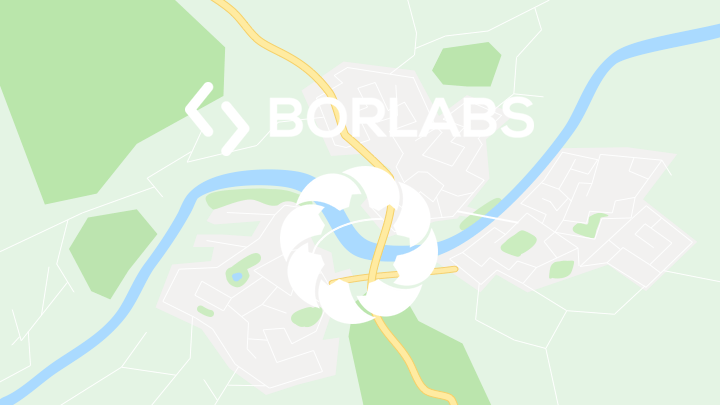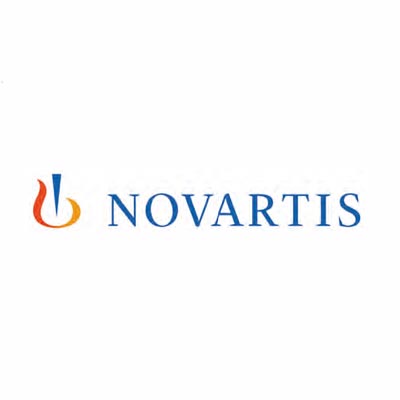NATIONALER HERZSCHWÄCHETAG 2024
EINE ANMELDUNG ZUM WANDERTAG IST NICHT NOTWENDIG
Anlässlich des 4. Nationalen Herzschwächetages möchten wir mit Ihnen gemeinsam ein starkes Zeichen der Zuversicht für von Herzschwäche Betroffene setzen. Regelmäßige Bewegung führt zur einer Verbesserung der körperlichen Fitness bei Patienten mit Herzschwäche und ist ein guter Ausgleich für Körper und Seele. Wir richten uns an alle, die trotz Herzschwäche aktiv bleiben und ein „normales“ und erfülltes Leben führen wollen.
herz-aktiv.news:
Herzinsuffizienz-Patientin Christine Pichler im Interview

Machen Sie mit und wandern wir gemeinsam mit den Biathletinnen
LISA HAUSER & ANNA GANDLER.
Die Wanderung findet bei idealen Wanderwetterbedingungen am Samstag, 5. Oktober 2024 statt.
PRESSEGESPRÄCH am 20. September 2024
AKTIV gegen Herzschwäche
Mit Früherkennung Lebensqualität verbessern und Spitäler entlasten


Fotogalerie von 05. Oktober 2024
Hier können Sie die Einladung zu
„Wandern mit Herzschwäche
herunterladen:

geboren am 5. Jänner 2001 in Hall in Tirol, gilt als eine der größten Biathlonhoffnungen in Österreich.
Sie konnte ihr Talent schon mehrmals beweisen u.a. war sie Jugendweltmeisterin, Junioreneuropameisterin gewann eine Bronzemedaille bei den Jugend Olympischen Spielen sowie weitere Medaillen bei Jugend- und Junioren Weltmeisterschaften.
Auch im Weltcup konnte sie sich schon beweisen, neben der besten Platzierung als 5. stehen noch weitere 4 Top 10 Platzierungen zu Buche.

… ist eine österreichische Biathletin und ehemalige Skilangläuferin.
Geboren am 16. Dezember 1993 in Kitzbühel.
Mit einer Gold- und drei Silbermedaillen bei Weltmeisterschaften sowie sieben Weltcupsiegen ist sie die bisher erfolgreichste österreichische Biathletin.
In den Wintern 2021/22 und 2022/23 platzierte sich Hauser unter den besten zehn Athletinnen der Gesamtwertung im Weltcup und stand in mehreren Einzelrennen auf dem Podest. Sie feierte in den beiden Jahren insgesamt drei weitere Weltcupsiege: im Dezember 2021 bei einem Sprintrennen in Östersund sowie im Dezember 2022 beim Sprint in Kontiolahti und beim Massenstart in Annecy-Le Grand-Bornand.

geboren am 5. Jänner 2001 in Hall in Tirol, gilt als eine der größten Biathlonhoffnungen in Österreich.
Sie konnte ihr Talent schon mehrmals beweisen u.a. war sie Jugendweltmeisterin, Junioreneuropameisterin gewann eine Bronzemedaille bei den Jugend Olympischen Spielen sowie weitere Medaillen bei Jugend- und Junioren Weltmeisterschaften.
Auch im Weltcup konnte sie sich schon beweisen, neben der besten Platzierung als 5. stehen noch weitere 4 Top 10 Platzierungen zu Buche.

… ist eine österreichische Biathletin und ehemalige Skilangläuferin.
Geboren am 16. Dezember 1993 in Kitzbühel.
Mit einer Gold- und drei Silbermedaillen bei Weltmeisterschaften sowie sieben Weltcupsiegen ist sie die bisher erfolgreichste österreichische Biathletin.
In den Wintern 2021/22 und 2022/23 platzierte sich Hauser unter den besten zehn Athletinnen der Gesamtwertung im Weltcup und stand in mehreren Einzelrennen auf dem Podest. Sie feierte in den beiden Jahren insgesamt drei weitere Weltcupsiege: im Dezember 2021 bei einem Sprintrennen in Östersund sowie im Dezember 2022 beim Sprint in Kontiolahti und beim Massenstart in Annecy-Le Grand-Bornand.
Wir danken unseren Partnern:
HERZSCHWÄCHE (HERZINSUFFIZIENZ)
HERZSCHWÄCHE (HERZINSUFFIZIENZ)
Die chronische Herzschwäche gehört in Österreich zu den häufigsten Erkrankungen. Sie führt zu Luftnot bei körperlicher Anstrengung und kann die Lebensqualität in hohem Ausmaß beeinträchtigen.
Die moderne Medizin bietet zwar keine Heilung, kann aber den Krankheitsverlauf deutlich verlangsamen und sogar eine Verbesserung der Lebensqualität bewirken.
Von Herzschwäche Betroffene können durch achtsamen Umgang mit ihrer Erkrankung und ihrem Körper viel zur erfolgreichen Behandlung beitragen.
Insbesondere regelmäßige, körperliche Aktivität ist ein Meilenstein in der Therapie der Herzschwäche.
Anlässlich des Internationalen Herzschwäche-Tages möchten wir mit Ihnen gemeinsam ein starkes Zeichen der Zuversicht setzen. Wir möchten zeigen, dass es Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche auch gut gehen kann.
Herzinsuffizienz: Eine wachsende medizinische und wirtschaftliche Herausforderung
Die Herzinsuffizienz (Herzschwäche) stellt in allen ihren Ausprägungen (HfrEF, HFpEF, akut oder chronisch, therapieinduziert) eine zunehmende medizinische und wirtschaftliche Herausforderung dar.
Vor 30 Jahren stand die Herzschwäche noch im Schatten anderer kardialer Erkrankungen und wurde entweder als untherapierbare Endstrecke der Kardiologie betrachtet oder wenn noch in einem früheren Stadium als bedeutungslos ignoriert.
Risikofaktoren und präventive Behandlung von Herzinsuffizienz
Seit damals hat sich eine medizinische Revolution ereignet, welche die Herzinsuffizienz in den Mittelpunkt gerückt hat. Diabetes, Hypertonie oder Adipositas genauso wie alle kardialen Erkrankungen, werden als Risikofaktoren zur Entwicklung einer Herzinsuffizienz gesehen und eine zeitige Behandlung als primärpräventiven Eingriff.
Dies führt notwendigerweise zu einer Verschiebung in der kardialen Gewichtung und stellt die Herzinsuffizienz in den Mittelpunkt der Kardiologie. Diese vergangenen 30 Jahre haben zur Entwicklung von Therapien geführt, die mit keiner anderen Herzerkrankung und den wenigsten anderen internistischen Erkrankungen mithalten kann.
Neue Medikamenten-Therapien
Alleine vier Medikamente, die die Lebenszeit deutlich verlängern und dazu noch zahlreiche andere Medikamente, die die Spitalsrate deutlich reduzieren. Dank der dadurch verbesserten Lebensqualität können Menschen trotz körperlicher Einschränkungen wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben und ihr Leben selbstständig führen.
Innovative Technologien und die Weiterentwicklung in der Behandlung
Gleiches gilt für die Entwicklung von implantierbaren Geräten (Schrittmacher, Kunstherz), Kathedereingriffen zur von herzinsuffizienzbedingten Klappenschwächen bis hin zu implantierbaren Systemen, die wichtige Informationen via Telesystemen an die behandelnden Ärzt*innen übersenden können.
Vor Allem Letzteres führt natürlich auch zu einer permanenten Zunahme an zu bearbeitenden Informationen. Die Entwicklung steht jedoch bei weitem nicht am Ende. Zahlreiche derzeit laufende Studien erweitern voraussichtlich das therapeutische Arsenal.
Gemeinsame Strategien für die Frühphase der Erkrankung
Frühe Erkrankungsformen können in der Regel von einem erfahrenen Allgemeinmediziner oder Internisten betreut werden. Dem hat die Arbeitsgruppe für Herzinsuffizienz zusammen mit der österreichischen Gesellschaft für Allgemeinmediziner Rechnung getragen und ein gemeinsames Strategiepapier verfasst, wie die Betreuung in die jeweils richtigen Hände gelegt werden kann.
Der Bedarf an Spezialisten für fortgeschrittene Stadien
Mit Zunahme der Schwere verlangt die Erkrankung jedoch Spezialist*innen um oben genannte Therapie personifiziert den Erkrankten zur Verfügung zu stellen. Die internationalen Richtlinien haben hier sehr genaue Vorgaben, welche Versorgungstruktur die besten Ergebnisse erzielen kann.
Hier können Sie die Broschüre
„BESSER LEBEN MIT HERZINSUFFIZENZ
Information für Patienten mit Herzschwäche“
herunterladen:
Hier können Sie die Broschüre
„BESSER LEBEN MIT HERZINSUFFIZENZ
Information für Patienten mit Herzschwäche“ herunterladen:
TYPISCHE ANZEICHEN:
Die chronische Herzschwäche zählt weltweit zu den häufigsten Erkrankungen. Sie beschreibt einen Krankheitszustand, bei dem die Herzfunktion nicht mehr ausreicht, um den Körper ausreichend mit Blut, und damit Sauerstoff, zu versorgen.
Grundsätzlich können alle Herzerkrankungen (z.B. Herzklappenerkrankungen, koronare Herzerkrankung, Herzrhythmusstörungen oder Herzmuskelentzündung) in diesem Zustand münden. Daher ist die Abklärung der Ursache einer Herzschwäche entscheidend, um eine genaue Behandlung zu ermöglichen.
Das Leitsymptom der Herzschwäche ist die Luftnot, deren Ausmaß auch den Schweregrad der Erkrankung widerspiegelt.
Weitere Symptome beinhalten schnellere Erschöpfbarkeit, zunehmende Müdigkeit und Schwindel.
Zu den Zeichen der Herzschwäche gehören Wassereinlagerungen in den Beinen oder auch Ergüsse im Lungenspalt oder im Bauchraum, weiters können Herzrhythmusstörungen auftreten.
Weniger typisch, aber auch häufig sind Appetitlosigkeit, Depressionen bzw. Herzstolpern. Gewichtszunahme, aber auch Gewichtsverlust sind zwar weniger spezifisch bei Herzschwäche, spielen aber im Krankheitsverlauf eine wesentliche Rolle.
Alle Symptome und Zeichen der Herzschwäche können auch bei anderen Erkrankungen auftreten bzw. sind teilweise auch subjektiv und schwer messbar (z.B. Müdigkeit und Erschöpfbarkeit).
Der erste Schritt ist daher die Objektivierung der Beschwerden, z.B. mittels eines Belastungstests oder der Bestimmung von Laborparametern.
Bei einem plötzlichen Auftreten von Atemnot und/oder Druck auf der Brust sollte die nächste Notaufnahme aufgesucht werden.
Der Verdacht auf das Vorliegen einer Herzschwäche kann mittels der Bestimmung des Laborwerts NT-proBNP und der Durchführung eines EKGs erhärtet werden.
Die zentrale Methode zur exakten Herzschwäche-Diagnostik ist der Herzultraschall. Bei diesem kann nicht nur die Herzfunktion gemessen werden, sondern auch eine ursächliche Abklärung erfolgen.
Die Vertiefung der Diagnostik erfolgt meist mittels Bildgebung (z.B. Magnetresonanztomographie) und Herzkatheteruntersuchung.
Durch einen gesunden Lebensstil können Patientinnen und Patienten sehr viel zum Genesungsprozess beitragen. Aus medizinischer Sicht besteht die Basistherapie der chronischen Herzschwäche in einer zeitgemäßen medikamentösen Therapie, die bereits sehr gute Erfolge erzielen kann.
Je nach Ursache ist eine invasive Behandlung notwendig, z.B. das Aufdehnen von Engstellen in den Herzkranzgefäßen bei koronarer Herzerkrankung oder der Herzklappenersatz bei Herzklappenfehlern. Auch Rhythmus-Probleme können mittlerweile sehr erfolgreich mit Eingriffen behandelt werden (z.B. Katheterablation bei Vorhofflimmern).
Eine herzchirurgische Operation kann notwendig sein, wenn z.B. Herzklappenerkrankungen oder koronare Herzerkrankung als Ursache vorliegen.
In der modernen Herzmedizin können mittlerweile sehr viele Eingriffe erfolgreich interventionell (d.h. nicht-operativ) durchgeführt werden, d.h. mittels Zugangs zum Herz über Leisten- oder Unterarm-Gefäße. Sogar der Ersatz oder die Reparatur von Herzklappen kann interventionell durchgeführt werden.
Ein gesunder Lebensstil beinhaltet körperliche Aktivität und ist ein Meilenstein in der Behandlung der Herzschwäche. Patientinnen und Patienten sind dazu angehalten, sportlich aktiv zu sein! Lediglich ist zu beachten, dass die Belastungsschwelle langsam und kontrolliert gesteigert werden sollte.
Auch bei Herzschwäche gilt: „Wer rastet, der rostet“. Gesundheitssport sollte 3-5-mal pro Woche für jeweils 30–60 Minuten und 52 Wochen im Jahr durchgeführt werden.
Gerade nach Erstdiagnose einer Herzschwäche empfiehlt sich die Absolvierung einer Reha, bei der Patientinnen und Patienten lernen ihre Belastungsgrenze, z.B. gemessen am Puls, zu erkennen.
Wenn bei der Diagnose der Herzschwäche ein ungesunder Lebensstil – z.B. Rauchen, Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung – vorliegt, können durch eine Änderung des Lebensstils hin zu mehr Bewegung und gesunder Ernährung große Erfolge erzielt werden. Oft sind diese größer als durch Medikamente.
Deshalb sollten Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche das Bewusstsein für einen gesunden Lebenswandel und ihren Körper schärfen.
Neben regelmäßiger Bewegung und aus gewogener Ernährung ist ein ausreichender Zeitraum für Erholung und Entspannung eine weitere Grundlage für einen gesundheitsfördernden Lebensstil.
Erholung bedeutet für jede und jeden etwas anderes: das kann Lesen sein, ein Besuch in der Therme, eine Urlaubsfahrt oder eine gesellige Runde mit Freunden. Wichtig ist auch, dass man auf ausreichend Schlaf achtet.
Eine Behandlung der Herzschwäche macht vor allem Sinn, wenn Patientinnen und Patienten selbst Interesse an einer Gesundung haben. Rauchen im Allgemeinen und Übergenuss von Alkohol sind bei Herzschwäche schädlich und sollten deshalb vermieden werden.
Alkohol kann die Herzmuskelzellen weiter schädigen, beschleunigt den Herzschlag, steigert den Blutdruck und zwingt dadurch das Herz zu Mehrarbeit.
Maßvoller Alkoholgenuss hingegen gilt nicht als schädlich, bei koronarer Herzerkrankung wird maßvollem Rotweingenuss sogar eine nützliche Wirkung nachgesagt.
Die chronische Herzschwäche ist zumeist nicht heilbar. Häufig ist aber ein Zustand erreichbar, in dem die Atemnot nur bei starker körperlicher Belastung auftritt und eine gute Lebensqualität besteht. Die besten Behandlungserfolge werden erzielt, wenn Arzt und Patient mit vereinten Kräften an der Behandlung arbeiten und neben der modernen Herzmedizin viel Wert auf einen gesunden Lebensstil und Körperbewusstsein gelegt wird.
ÜBER UNS
Die Arbeitsgruppe Herzinsuffizienz in der Österreichischen Kardiologischen Gesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt das Krankheitsbild „Herzinsuffizienz“ durch Aufklärung, Forschung, Fort- und Weiterbildung sowie durch nationale und internationale Kooperationen einer breiten Öffentlichkeit vertraut zu machen.

Dr. Anna Rab

DDr. Peter Rainer

Dr. Gerhard Pölzl

Dr. Johann Altenberger